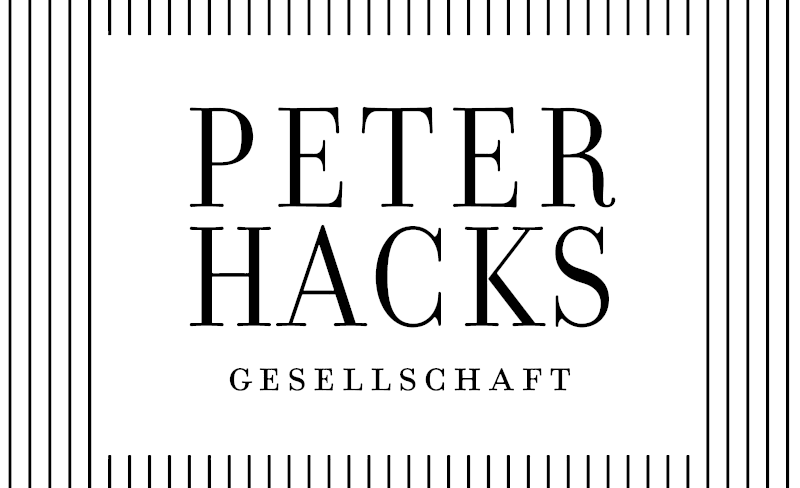Prof. Dr. Heinz Hamm
10.15 Uhr
Im Mittelpunkt der »Omphale« steht ein Tausch der gesellschaftlichen Rollen des männlichen und des weiblichen Geschlechts. Der Beitrag fragt nach Sinn und Zweck dieses Rollentauschs, den Herakles freiwillig vornimmt und den Omphale ihrerseits freiwillig nachvollzieht.
Hacks will zweifellos keine Travestie-Show veranstalten. Auch erschöpft sich die Bedeutung der »Omphale« nicht darin, für die Gleichberechtigung der Geschlechter, für den »allseitig ausgebildeten Menschen« und »die individuelle Entfaltung eines Jeden« einzutreten. Hacks macht Grundfragen des Menschenbildes zum Thema. Er stellt in Herakles, der zugleich Mann und Frau sein möchte, den »wiederhergestellten Menschen« dar, einen Menschen, der nach einem verlustreichen Gang durch die Geschichte die durch Arbeits- und Geschlechterteilung bedingten Einseitigkeiten und Beschränkungen hinter sich läßt und damit wieder ein ganzer Mensch wird. Unverkennbar ist hier der Bezug auf die »allgemeine menschliche Emanzipation«, wie sie der 26-jähríge Marx in Anlehnung an Ludwig Feuerbach in seinen Pariser Schriften einfordert. Im Gang der Handlung scheitert das Vorhaben des Herakles, die Schranken der Arbeits-und Geschlechterteilung zu überwinden, weil er sich gezwungen sieht, wieder als einseitiger Heroe das Ungeheuer Lityerses zu vernichten. Das Scheitern ist jedoch unabhängig von Lityerses; es betrifft das Vorhaben als solches. Das gilt auch für den Wunsch der Königin Omphale, sich aus der biologischen Existenz als Frau zu emanzipieren. Hacks läßt in »Omphale« eine Utopie auftreten und nimmt sie sogleich wieder zurück; denn für ihn wird es, was Marx mit der »menschlichen Emanzipation« als historische Aufgabe stellt und für machbar hält, niemals in der Wirklichkeit geben. Das letzte Wort hat gleichwohl ein optimistisch in die Zukunft blickender Herakles. Der Gegenentwurf des aus der »Entfremdung« befreiten »wiederhergestellten Menschen« bleibt ein echtes Ideal, dem immer nachzustreben ist.
Hier können Sie den Vortrag nocheinmal hören und sehen:
Prof. Dr. Heinz Hamm, geboren 1944, ist Germanist. Er promovierte 1972 mit einer Arbeit über die theoretischen Auffassungen des späten Goethe zu Kunst und Wirklichkeit und lehrte u.a. in Halle, Paris, Warschau und Jena. 2000 bis 2010 war er Mitarbeiter der Mommsen Foundation for the Advancement of Goethe Research. Im Aurora Verlag erschien zuletzt »Der falsche Zeuge. Irrwege der Goethe-Forschung« (2013).