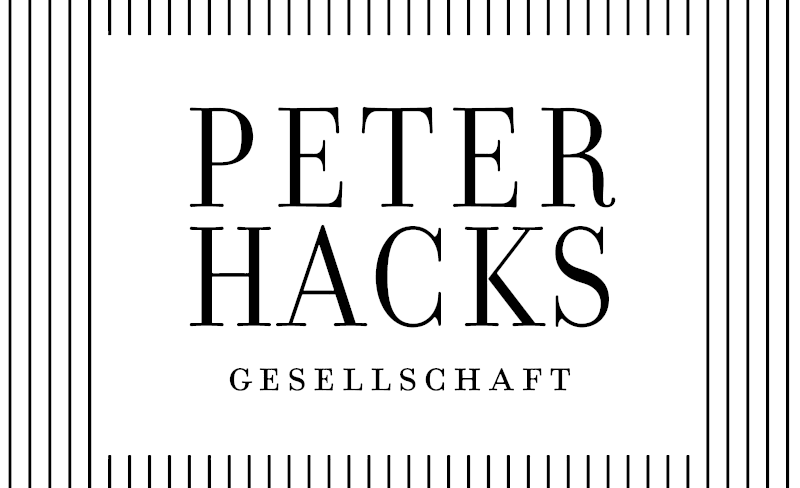Tagung
Tagung 2020

„Unendlich nur ist der Zusammenhang“
Hacks und der Marxismus
Dreizehnte wissenschaftliche Tagung der Peter-Hacks-Gesellschaft e.V.
Die Tagung soll klären, inwieweit Hacks an Werke von Klassikern wie Marx, Engels, Luxemburg und Lenin anknüpfte, welche Rolle die theoretischen Fortentwicklungen im Rahmen sozialistischer Staatlichkeit für ihn spielten, wie er die marxistische Philosophie des 20. Jahrhunderts und die Wissenschaft in der DDR rezipierte. Zudem geht es um seine produktive Weiterarbeit mit diesem Erbe, um den Zusammenhang, in den Hacks die Arbeiten von Marx stellte („Wer Goethe sagt, muss Hegel sagen, und wer Hegel sagt, sagt Marx“) und wie er sich mit Strömungen auseinandersetzte, die er ablehnte (Trotzkismus, Maoismus, die Neue Linke im Westen). Damit soll die Tagung auch zu einer politischen Biographie von Peter Hacks beitragen und erhellen, welche Auswirkungen die Einschnitte in der Geschichte der DDR und ihr Ende auf sein Denken hatten.
Termin: Sonnabend, 31. Oktober 2020
Ort: Magnus-Haus, Berlin
Am Kupfergraben 7, 10117 Berlin-Mitte
10 Uhr bis 18 Uhr
Vorträge der Tagung
10.00 Uhr Prof. Dr. Heinz Hamm (Halle/Saale)
Der "Traum der Klassiker" von der "abgeschafften Arbeitsteilung": Marx-Kritik in der "Schönen Wirtschaft" von Peter Hacks Marx lehnt ab, die zukünftige kommunistische Gesellschaft in ihren Grundzügen genauer zu beschreiben. Gleichwohl sagt er Grundsätzliches aus, welche Erwartungen er an eine Gesellschaft knüpft, in der das Privateigentum an den Produktionsmitteln aufgehoben ist. Eine dieser Aussagen besteht in der Erwartung, dass es im Kommunismus keine Arbeitsteilung mehr geben wird. Dies hat als Lehrsatz, ebenso wie die Aufhebung der Klassenspaltung, das Absterben des Staates usw., in der Geschichte der Arbeiterbewegung und des Sozialismus eine zentrale Rolle gespielt. Hacks hält für notwendig, sich von Annahmen zu verabschieden, bei denen der Marxismus "auf schwachen Füßen" steht. In den "ästhetisch-ökonomischen Fragmenten" von 1988 übt er am "Marxschen Entwurf von der abgeschafften Arbeitsteilung" scharfe Kritik. Erstmals wird damit in der DDR ein zentraler Lehrsatz des Marxismus von einem Marxisten in Frage gestellt.
10.45 Uhr Dr. Detlef Kannapin (Berlin)
"'Hermlin empfiehlt'. Die Selbstabschaffung des Sozialismus aus marxistischer Sicht.“
Die Seiten 84 bis 87 der HW 15 enthalten in höchst konzentrierter Form die wesentlichen Aspekte der Selbstabschaffung des Sozialismus in der DDR. Aus marxistischer Sicht stellt sich die Frage, wie diese Selbstabschaffung ins Werk gesetzt wurde und was sie für die zukünftige Entwicklung der menschlichen Gesellschaft bedeutet. Ziel des Vortrages ist zum einen die Analyse der formationstheoretischen Grundlagen der hier niedergelegten Essenz politischer Rationalität von Peter Hacks. Zum anderen ist beabsichtigt, aus erkenntnistheoretischer Sicht die Konsequenzen der Selbstabschaffung des Sozialismus für die politische Philosophie aufzuzeigen."
Kurze Pause
11.45 Uhr Prof. Shaswati Mazumdar (Neu-Delhi)
Imperialismus-Kolonialismus im Werk von Peter Hacks
„Kapitalismus“ wird im Werk von Peter Hacks immer austauschbar mit dem Begriff Imperialismus verwendet. Hacks bezeichnet den Kapitalismus als Imperialismus schlechthin. Das geschieht bei ihm auch dann noch, als durch den Untergang des Sozialismus in Europa und den globalen Aufschwung eines ‘neoliberalen’ Kapitalismus der Begriff Imperialismus im Mainstream- wie auch im marxistischen Diskurs immer weniger verwendet wurde und man sich aus der Sicht der Länder der Dritten Welt fragen musste “Whatever happened to Imperialism?” Der Beitrag geht der Frage nach, welche Aspekte des Begriffs Imperialismus eine besondere Beachtung in seinem Werk finden. Während sein Hauptaugenmerk natürlich auf dem Aufbau des Sozialismus – in Konfrontation/Konkurrenz mit dem Imperialismus – lag, liegt der Fokus des Beitrags mehr auf dem Kolonialismus und der sogenannten postkolonialen Welt.
12.30 Uhr Prof. Dr. Gerhard Bauer (Berlin)
Hacks als Könner und scharfsinniger Theoretiker des Theaters, nur als Räsoneur über den rechten Weg zum Sozialismus allerdings eher vorlaut.
Peter Hacks war mit Lust in die DDR übergesiedelt (1955). Er hoffte dort sogar noch den Übergang zum „Kommunismus“ zu erleben. Ihm wurde aber bedeutet, dass für die Bewertung der politischen Entwicklung andere, eben Berufspolitiker, zuständig waren. Wenn er dazu Stellung nehmen wolle, solle er das gefälligst auf „seinem“ Gebiet tun: in Aufbaustücken, historischen Dramen, Komödien und Opern. Dazu bequemte er sich allmählich, obzwar ungern. Dafür suchte und fand er jetzt aber Gelegenheit, weitreichende Perspektiven bis hin zu seiner Lieblingsvorstellung: Freiheit im Sozialismus, in seine Stücke einzubauen und seine Produktion anspielungsreich zu kommentieren. Auffällig ist dabei, dass er einerseits die Abriegelung der DDR („die Mauer“) begrüßt und daran festgehalten hat, in seinen Stücken aber, andeutungsweise im „Amphitryon“, unübersehbar in „Adam und Eva“, die freie Entscheidung und das Weggehen aus eigenem Willen propagiert hat.
Mittagspause
14.00 Uhr Marlon Grohn (Köln)
Volk, Demokratie und Absolutismus – die Frage der Machtbasis im Sozialismus bei Peter Hacks
Peter Hacks entwickelt in seinen Dramen und Essays eine konsequente Fortführung der marxistischen Theorie, bei der er sich vor allem auf die nach Marx gewonnenen historischen Erfahrungen von Kommunisten, ihren Revolutionen und ihren Staaten stützt. Er reformuliert unter geänderten Bedingungen wichtige Aspekte der Staats- und Demokratietheorie des Marxismus – vor allem Fragen der Macht und des institutionellen Fundaments, auf dem diese im Sozialismus beruhen soll. Er kommt in mehreren seiner Werke zu einer explizit fortschrittlich demokratiefeindlichen Haltung. – Der Beitrag will seinen Fokus insbesondere auf die in den Hacks-Werken entfalteten Begriffe von "Volk" und "Demokratie" richten und diese mit denen von Marx und Engels abgleichen.
14.45 Uhr Mgr. Daria Šemberová (Prag)
Hacks’ Rezeption des Luxemburgismus am Beispiel der Komödie Der Frieden
Der Vortrag verfolgt die Spuren des Luxemburgismus in der aristophanischen Komödie „Der Frieden“, die am 14. Oktober 1962 unter der Regie von Benno Besson am Deutschen Theater Berlin uraufgeführt wurde. Er setzt sich mit der Aktualität des Denkens von Rosa Luxemburg im Stück auseinander. 101 Jahr nach ihrer Ermordung soll untersucht werden, wie ihr philosophisch-politisches Denken den ostdeutschen Dramatiker beeinflusste. Bezug genommen wird insbesondere auf ihren Text „Friedensutopien“, den sie drei Jahre vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges verfasst hatte.
Kurze Pause
16.00 Uhr Fabiana Paciello (Italien)
Peter Hacks und der Klassenbegriff
Dieser Begriff wurde bei Hacks zum ersten Mal 1971 formuliert in der Annahme, dass das beste politische System von zwei Klassen geleitet werden müsse: von Arbeiterklasse und Intelligenz. Zur Arbeiterklasse gehören die hauptamtlichen Mitarbeiter der Partei, zur Intelligenz die wissenschaftlichen und technischen Angestellten. Eine dritte Macht müsste kontrollieren, dass die zwei Klassen gut mitarbeiten, ohne in Konflikt zu geraten. Der Politiker Walter Ulbricht vertrat nach Hacks Meinung diese Macht am besten.
Im Vortrag werden anhand einiger Essays aus der 2018 veröffentlichten Sammlung „Marxistische Hinsichten. Politische Schriften 1955-2003“ die Gründe bestimmt, aus denen Hacks die Notwendigkeit des Zusammenlebens dieser beiden zwei Klassen ableitete. Dabei wird besonders auf begriffliche Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Hacks und Lenin eingegangen.
16.45 Uhr Jakob Hayner (Berlin)
Die Romantik als Zentrum einer marxistischen Ästhetik?
Nach dem marxistischen Literaturtheoretiker Terry Eagleton gibt es in der Moderne drei zentrale Fragen: Was können wir wissen? Was sollen wir tun? Wozu fühlen wir uns hingezogen? Die letzte Frage sei in besonderem Maße dem Ästhetischen zugehörig. Die Künstler arbeiten an den Empfindungen der Menschen und somit am Möglichkeitssinn der Menschheit. Nun gibt es nach Eagleton in der Moderne aber eine Spielart des Ästhetischen, die sich im Gegenteil dem Unmöglichkeitssinn verschrieben hat. Die wird für gewöhnlich Romantik genannt. Wie kaum ein anderer hat Peter Hacks die Frage der Romantik als zentral für den Klassenkampf in der Literatur verstanden. Unermüdlich polemisierte er gegen diese Geisteshaltung und ihre Wiederkehr – so zum Beispiel in seiner späten Schrift "Zur Romantik". Traf Hacks damit den Kern einer marxistischen Ästhetik? Das soll in dem Vortrag diskutiert werden – insbesondere mit einem Seitenblick auf die romantizistisch-postmoderne Kultur unserer Zeit.
Moderation: Felix Bartels und Dr. Klaus Rek
Sie können die Tagung auf dem YouToube-Kanal der Peter-Hacks-Gesellschaft verfolgen.
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Ausgewählte Referate werden im Hacks Jahrbuch 2021 veröffentlicht.
Neunte wissenschaftliche Hacks-Tagung
Tagungsrückblick 2016
»Machen Sie nicht weiter so«
Hacks in Dialog und Kontroverse mit Kollegen
Neunte wissenschaftliche Tagung zu Werk und Leben von Peter Hacks
Am 12. November 2016 fand im Magnus-Haus am Kupfergraben die neunte wissenschaftliche Tagung zu Werk und Leben von Peter Hacks statt.
Ein zahlreiches und beständiges Publikum hörte und diskutierte sechs Referate.
Zuerst beschrieb Ronald Weber "das erhoffte Triumvirat der sozialistischen Klassik", das Peter Hacks nach 1961 in sich und den Dramatikerkollegen Heiner Müller und Hartmut Lange antreten sah. Alle drei Dramatiker wandten sich im Laufe der 1960er Jahre vom Brecht-Epigonentum und vom Gegenwartsdrama ab, das sie als wenig poesiefähig einschätzten. Alle drei suchten, historische und mythologische Stoffe in höchsten Formen, insbesondere versifiziert, zu bewältigen. Und alle drei hatten kulturpolitische Probleme von Ausmaßen, die darauf hinwiesen, dass ihre Dramen die empfindlichsten Nerven der Gegenwart trafen. Mit der Flucht Hartmut Langes aus der DDR und der romantischen Wende Heiner Müllers sei das Triumvirat jedoch zerfallen, noch bevor es zur Höhe seiner selbst gelangt sei.
Leonore Krenzlin schloss mit einer Analyse des Verhältnisses von Peter Hacks und Wolf Biermann an, die sie als "zwei Außenseiter im literarischen Feld der DDR" bezeichnete. Beide hätten, aus Westdeutschland eingewandert, gewisse Privilegien und Westverbindungen genossen und sich daher mehr ästhetische sowie politische Experimente leisten und trauen können. Bis 1965 hätten sie sich auch gut verstanden, und erst ihre unterschiedlichen Reaktionen auf das 11. Kulturplenum hätten sie auseinander- und gegeneinander gebracht. Den Aufsatz "Neues von Biermann" von 1976, in dem Hacks die Ausbürgerung Biermanns unterstützte, habe Hacks als politisch notwendig für die Verteidigung des Sozialismus in der DDR betrachtet. Er habe Biermann jedoch noch 1984 in seinem Balladen-Essay würdigend erwähnt und damit die Bereitschaft zur Änderung seiner ästhetischen Beurteilung Biermanns gezeigt, sei daher keineswegs prinzipiell oder persönlich zänkisch gegen Biermann eingestellt gewesen. Biermann habe sich seit 1976 nicht mehr substantiell zu seinem Verhältnis zu Hacks geäußert.
Gunter Nickel nannte die jüngst erschienene Dissertation von Ronald Weber über das Verhältnis von Hacks und Müller profund und materialreich, kritisierte aber eine zu unbesehene Übernahme kultursoziologischer Untersuchungsmethoden Pierre Bourdieus, mit denen insbesondere Hacks' Poetik und marxistisches Selbstverständnis nicht gründlich genug zu fassen sei. An Heiner Müllers "Macbeth"-Bearbeitung habe Hacks gerade das kritisiert, was Bourdieus Kultursoziologie zu abstrakt hervorhebe. Müllers "Macbeth" stelle auf eine allgemeine Macht-Schelte ab, die alle widerspruchsträchtigen Elemente aus der Shakespeareschen Vorlage getilgt habe. Schließlich wies Nickel darauf hin, dass der späte Goethe den Gegensatz der Klassik zur Romantik entschärft habe und selber zum Nachklassiker geworden sei. Eine ähnliche Entwicklung sei auch bei Hacks zu beobachtenAuch Hacks' spätes Werk weise auf eine solche nachklassische Schaffensphase hin, woraus entsprechende Schlussfolgerungen für die Romantik-Debatte in und nach der DDR zu ziehen seien.
Bernd Leistner untersuchte "Hacksens Verwandtschaft in der literarischen DDR" anhand seines Verhältnisses insbesondere zu Rainer Kirsch und Karl Mickel. Hacks habe sich nie abgesondert, sondern stets die poetologische Debatte gesucht und zum Beispiel in seiner Arbeitsgruppe an der Akademie der Künste auch aktiv organisiert. Mit Mickel und Kirsch teilte Hacks die Wertschätzung des formgebundenen, 
Detlef Kannapin gab einen Überblick über Hacks' seit je spärliche Beziehungen zu westdeutschen Schriftstellern, die sich seit seiner Übersiedlung in die DDR immer schlechter gestalteten. Noch in den 1960er Jahren habe Hacks sich zu Versuchen grenzüberschreitender ästhetisch-politischer Bündnispolitik aufraffen können, weil die Kräfteverhältnisse sowohl in der BRD als auch in der DDR es gestatteten. Doch kamen schon vor 1968 außer dem politisch versierten André Müller und dem ästhetisch hochrangigen, jedoch für Bündnisse wiederum zu abgesonderten Arno Schmidt wenige Autoren in der BRD überhaupt infrage. Dies zeige bereits der gescheiterte Annäherungsversuch Hacks' an Hans Enzensberger 1959-62. Seit der Reformierung des Bewusstseins und Überbaus der BRD durch die sogenannten 1968er sei auch in der DDR das politische und ästhetische Selbstverständnis von immer mehr Künstlern hin zu teils scheinradikal und marxistisch drapierter, teils offener Apologie des Imperialismus verflacht. Hierfür sei die Entwicklung Heiner Müllers zum BRD-Autor bis spätestens 1978 exemplarisch. Versuche zu Zweckbündnissen nach 1990, etwa mit Horst Tomayer oder Robert Gernhardt, seien entsprechend der Epoche nach der Zerstörung der DDR auf notdürftigere, rein antiimperialistische Ziele beschränkt gewesen.
Die Tagung endete mit einem Vortrag von Dietmar Dath zur gegenwärtigen gesellschaftlichen Lage und den Möglichkeiten und Schwierigkeiten der Hacks-Rezeption angesichts ökonomischer Zwänge und eines weltweiten epochalen Kulturverfalls. Die Unfähigkeit des bürgerlichen, imperialistischen "Diesseits" im schlechtesten Sinne, nach 1990 etwas anderes als kleinlichste Selbstsucht, Selbst-Unzufriedenheit und Todessehnsucht zu denken, zeige sich besonders deutlich an der neuerrichteten Mauer aus blankem, breitem Unverständnis gegenüber Hacks' Werk. Der negative Gegenwartsbefund müsse lauten, dass das Bewusstsein für Sprache und Kunst überhaupt, für die Einheit von Form und Inhalt, für die Rangordnung von Gattungen und Stoffen im Maße schwinde, wie das Diesseits als unveränderlich vergötzt oder wehklagend hingenommen wird. Umgekehrt hülfen insbesondere Hacks' Dramen, wenn sie als "Dialog im Jenseits" mit der absolutistischen und sozialistischen Vergangenheit einerseits und der kommunistischen Zukunft andererseits verstanden werden, die Kunstfähigkeit des Menschen in entsprechenden gesellschaftlichen Verhältnissen zu erkennen und nicht angesichts der verzweiflungsträchtigen Gegenwart zu vergessen.
Das komplette Tagungsprogramm als Flyer zum Download.
Die Referate der Tagung sind im Jahrbuch 2017 der Peter-Hacks-Gesellschaft erscheinen.
Mit freundlicher Unterstützung von:

![]()
![]()
Tagung 2019
Tagung 2019
Menschenlehrlinge
Kinderliteratur im Werk von Peter Hacks
Zwölfte wissenschaftliche Tagung der Peter-Hacks-Gesellschaft
Termin: Sonnabend, 2. November 2019
Ort: Magnus-Haus, Berlin
Am Kupfergraben 7, 10117 Berlin-Mitte
Was will der Bär auf dem Försterball?
Ein Klassiker des Kinderliteratur: Die 12. Peter-Hacks-Tagung in Berlin
Der 2003 verstorbene Peter Hacks war nicht nur Dramatiker und Lyriker, sondern auch Verfasser von Kinderliteratur. Wer einmal eines dieser phantastischen wie poetischen Werke gelesen hat oder gar das Vergnügen hatte, es in Kindertagen vorgelesen zu bekommen, wird es wohl kaum vergessen haben: den rätselhaften Ausflug eines tierischen Waldbewohners unter seine Feinde in »Der Bär auf dem Försterball«, die zahlreichen Verwandlungen der »Meta Morfoss« oder die Befriedung der Tierwelt durch die Kunst in »Das musikalische Nashorn«. Die Peter-Hacks-Gesellschaft hatte am vergangenen Samstag unter dem Titel »Menschenlehrlinge« zu ihrer jährlichen Tagung geladen, um die Kinderliteratur im Werk von Peter Hacks zu diskutieren. Am Vorabend hatte Jens Mehrle im Theater an der Parkaue Hacks’ Stück »Die Kinder« zur Aufführung gebracht – mit Schauspielern wie Ursula Werner und einem Kinderchor.
Die Vorträge am Samstag untersuchten verschiedene Aspekte der Kinderdichtung bei Hacks. Immer wieder Bezug genommen wurde auf den Aufsatz »Was ist ein Drama, was ist ein Kind?«, den man als theoretische Grundlegung und wohl auch Rechtfertigung des Dichters für die Kinderliteratur verstehen kann. In diesem stellt Hacks die besondere Empfänglichkeit der Kinder für Poesie und Phantastik heraus. Die Überlegung, für welches Publikum zu schreiben sei, führt ihn zu der Frage nach den angemessenen künstlerischen Mitteln. Dabei nimmt er das kindliche Publikum so ernst wie jedes andere, in seinen Bedürfnissen, aber auch seinen Fähigkeiten. Das Poetische und auch das Märchenhafte kommen dem kindlichen Werden entgegen, dem noch nicht Festgestellten der Heranwachsenden.
Auf der Tagung wurden Analysen einzelner Werke (etwa Leonore Krenzlin über den »Bär«), theoretische Überlegungen im Anschluss an Hacks (Felix Bartels) und Berichte aus der empirischen Forschung über Kinder bei der Hacks-Lektüre (Karin Richter/Christina Baumbach) vorgetragen. Deutlich wurde, dass es sich bei der Kinderliteratur keineswegs um eine Nebensache im Werk des Dichters handelt. Für jemanden, der so umfassend und weitblickend dachte wie Hacks, war es selbstverständlich, seine Leser auch schon unter den Jüngsten zu suchen. Doch können auch die Älteren mit nahezu kindlicher Freude und Ernst darüber diskutieren, ob der Bär nur zufällig auf dem Försterball landete, obwohl er eigentlich zum Maskenball wollte, ob er wusste, was er tat, oder der Alkohol ihm einen Streich spielte und welche geschichtlichen Vorbilder hinter dieser Figur zu vermuten wären.
Dem Reiz der Hacks’schen Kinderliteratur kann man sich kaum entziehen.
Jakob Hayner
Ausgewählte Referate der Tagung wurden im Hacks Jahrbuch 2020 veröffentlicht.
Die Tagung 2020 fand am 31. Oktober 2020 im Magnus-Haus in Berlin statt.
Tagung 2017
»Der erste Schritt ist allemal ein Stolpern«.
Hacks und Revolution
Zehnte wissenschaftliche Tagung zu Werk und Leben von Peter Hacks
Am Sonnabend, 4.11.2017 fand im Magnus-Haus, Berlin die zehnte wissenschaftliche Tagung zu Werk und Leben von Peter Hacks statt.
Auf der Tagung gab Klaus Rek (Halle) einleitend einen Überblick zur Entwicklung von Hacks’ Haltung zur Revolution seit dessen Übersiedlung in die DDR. Als wesentliche Stationen nennt er für die späten 50er Jahre eine operative Tendenzkunst, die durch ein »didaktisches Theater« und Gesangstexte wie dem später in die Werkausgabe nicht aufgenommenen »Oktober-Song« gekennzeichnet ist; nach Werken des Übergangs, »Moritz Tassow« etwa, eine postrevolutionäre, klassische Phase während der relativen Stabilität der DDR in den späten 60er und den frühen 70er Jahren; eine Abwehr gegenrevolutionärer Tendenzen in den letzten anderthalb Jahrzehnten der DDR; und nach deren Ende eine noch einmal intensivierte Auseinandersetzung mit den Mechanismen von Revolution und Konterrevolution sowie mit putschistischen Unternehmungen. Reks Fazit ist nicht ohne Skepsis, ob Hacks’ im Wesentlichen dramaturgischer Blick die tatsächlichen historischen Wirkkräfte in der DDR angemessen erfassen konnte.
Ein geplanter Vortrag von Jürgen Pelzer, der Hacks’ frühe operative Thea-terkonzeption in den kulturpolitischen Zusammenhang der Jahre 1956–61 eingebettet hätte, wurde leider abgesagt und ist erst im Jahrbuch 2019 veröffentlicht worden.
So folgten die Darlegungen von Kai Köhler (Berlin) zum Bild der Französischen Revolution bei Hacks. Hier geht es vor allem um das Fernsehspiel »Die unadlige Gräfin« von 1957, das in der Form klassizistisch geprägt ist und zugleich die Spontaneität aufrührerischer Volksmassen feiert. Darin zeigt sich ein Kontrast zu späteren, hierarchischen Konzepten, die mit der Hauptstadt die Bedeutung des Zentrums und in diesem die Rolle der führenden Persönlichkeiten betonen. Dabei überkreuzen sich die Frage danach, ob im Detail hässliche revolutionäre Vorgänge kunstfähig sind, und Hacksens Auseinandersetzung mit Verteidigern der Romantik.
Jakob Hayners (Berlin) Beitrag führt den Streit in die Gegenwart fort. Der Essay »Kunst und Revolution«, den Hayner zum Ausgangspunkt seiner Darlegungen nimmt, fasst zum einen die Position des klassischen Hacks zum Thema der Tagung zusammen. Zum anderen erweisen sich die Erkenntnisse von 1971 als Prüfstein für heutige Kunst, die sich als politisch und oppositionell versteht, aber sich im Bereich von moralisierenden Performances verliert.Der Beitrag von Gregor Schäfer (Basel) wurde in Abwesenheit verlesen. Er zeigt die Tradition, in die sich das Denken von Hacks über die Revolution stellt und für die insbesondere die politische Philosophie von Hegel und Lukács steht. Es geht dabei darum, Revolution nicht allein als den Moment zu verstehen, in dem eine alte Ordnung zertrümmert wird, sondern den Aufbau einer neuen Ordnung als notwendigen Bestandteil der Umwälzung zu begreifen. Darüber hinaus unterscheidet sich die Revolution von einem bloßen Machtwechsel dadurch, dass ein prinzipiell Neues in die Welt tritt, das auch die Gegner der Umwälzung dazu zwingt, sich in dieses neue Feld der Auseinandersetzung zu begeben. Insofern dieses Neue durch die sozialistische Revolution das anarchische Gegeneinander, das die bürgerliche Gesellschaft auszeichnet, in ein prinzipiell nichtantagonistisches Miteinander überführt, schafft sie Raum für eine klassische Kunst, wie Hacks sie entworfen und ausgeführt hat. Wie sich aber die Gesellschaft aus einem naturhaft Gegebenen zu einem planvollen Vorgehen erhoben hat, so ist auch die sozialistische Klassik keine naive, sondern reflektiert ihre eigenen Voraussetzungen, um sie überschreiten zu können. Dies weist Schäfer im Detail durch die Entwicklung der politischen und ästhetischen Theorie von Hegel zu Hacks nach.
Johannes Oehme (Berlin) widmet sich der politischen Konkretion und damit dem Anlass der Tagung. Wenn es auch kein Werk gibt, in dem sich Hacks mit der Oktoberrevolution beschäftigt hat, so zeigen doch seine Entscheidung für die DDR und viele Äußerungen in Briefen, Gesprächen und Essays, wie sehr er die Revolution in Russland und die Folgen, die Kommunisten dann in Deutschland geschaffen haben, als Grundlage seines Schaffens ansah. Das gilt auch für die Zeit nach 1989, in der sich Hacks mit den Ursachen des Scheiterns befasste und dabei mit der Rolle, die die Sowjetunion für das Ende der DDR spielte. Oehme arbeitet heraus, wie Hacks nicht die Revolution als Fehler begriff, sondern die opportunistische Abkehr von revolutionärer Politik.
Eine Niedergangsanalyse vor der Niederlage ist der Kinderroman »Liebkind im Vogelnest« von 1984, den Felix Bartels (Eberbach) eingehend interpretierte. Dabei widmete er sich erstens der Raumstruktur des Werks, ihrem politischen Erkenntniswert wie ihren Widersprüchen in der Darstellung von Sozialismus und Kapitalismus. Zweitens zeigt er das politische wie psychodynamische Verhältnis der Hauptfiguren zueinander, das die Handlung prägt. Hieraus wiederum lassen sich Beziehungen von Privatem und Öffentlichem, von Kunst und politischer Aktion erschließen, die nicht ineinander aufgehen, doch in Hacks’ Roman vielfältig aufeinander bezogen sind. Dabei geht es Bartels zufolge um die »Restauration einer Revolution«, das heißt darum, dass nach Hacks die sozialistische Gesellschaft für eine Entwicklung im Inneren wie gegen das kapitalistische Außen eine Politik zurückgewinnen musste, die sich nicht lediglich auf den zerbröckelnden Erfolgen der Vergangenheit ausruhen durfte.
Die von Hacks bekämpften Kritiker des Sozialismus sahen wie er die Niedergangserscheinungen in der späten Honecker-Zeit, jedoch nicht in der mangelnden Bereitschaft der DDR zur Konfrontation und in ökonomischer Ineffizienz, sie erklärten Defizite an Demokratie und eine verhärtete Blockkonfrontation zu Ursachen. In dieser kulturpolitischen Konstellation, die ihm den Zugang zu Theaterbühnen erschwerte, wandte sich Hacks anderen Gattungen zu. Noch vor dem Kinderroman ist dies der Essay.
Hans-Edwin Friedrich (Kiel) widmete sich dem essayistischen Werk der Wende- und unmittelbaren Nachwendejahre, wobei er insbesondere die poetologischen Voraussetzungen entwickelte. Der Essay behandelt einen – bei Hacks fast stets historischen – Gegenstand; aber indem er ihn behandelt, meint er auch die Gegenwart. Saul Ascher in »Einer von meinen Leuten« und Voltaire in »Ödipus Königsmörder« sind dabei einerseits von Hacks als Identifikationsgestalten angelegt. Doch schwindet andererseits die historische Differenz nicht. Politische Umwälzungen treten zum einen als Konterrevolutionen auf, die Hacks mit dem Begriff der Fronde fasst. Tatsächliche Revolutionen wie die Französische aber schildert Hacks mittels einer Konstruktion, die eine mehrstufige Distanzierung von hässlichen Einzelheiten erlaubt und so eine Möglichkeit eröffnet, das Verhältnis von Teil und Ganzem dialektisch zu begreifen.
Eingeleitet wurde die Tagung von zwei weiteren Veranstaltungen. Thomas Keck richtete eine Lesung des Stücks »Der falsche Zar« ein, in dem es zwar nicht um eine Revolution geht, aber doch um eine erfolgreich betriebene gewaltsame Machtübernahme. Das Drama verhandelt an einem historischen Stoff aus der russischen Zeit der Wirren Konfliktlinien im Russland der Entstehungszeit 1996. Indem es gegen den »falschen Zaren« geht, geht es gegen Jelzin. Verhandelt wird also zugleich die »Restauration einer abgebrochenen Revolution«, von der Hacks 1998 sprach und die auf der Tagung mehrfach thematisiert wurde.
Nach zweijähriger Unterbrechung fand auch wieder ein Arbeitstreffen für junge Wissenschaftler und Künstler statt. Dabei stellte Kerstin Hohner (Leipzig) ihre weitgehend abgeschlossene Dissertation zum Rostocker Hinstorff Verlag vor, der in den 60er Jahren unter der Leitung von Kurt Batt und Konrad Reich ein auf Gegenwartsliteratur ausgerichtetes Profil entwickelte. Hohner legte insbesondere die kulturpolitischen und ökonomischen Grundlagen der Verlagsgeschichte dar.
Martin Brandt (Berlin) stand hingegen vor der Aufgabe, das Thema seiner Masterarbeit, die mit Ronald M. Schernikaus »legende« als Ansatzpunkt sowohl historische Realismusdebatten im Konfliktfeld von Adorno und Lukács als auch das Verhältnis von Avantgarde, Realismus und Postmoderne klären soll, genauer zu fassen. Beide Projekte wurden eingehend besprochen.
Das komplette Tagungsprogramm als Flyer zum Download.
Die Referate der Tagung sind im Jahrbuch 2018 der Peter-Hacks-Gesellschaft erscheinen.
Mit freundlicher Unterstützung von:


![]()
Tagung 2018
Tagung 2018
Mensch sein ist Ursach sein
Realismus auf dem Theater
 Elfte wissenschaftliche Tagung der Peter-Hacks-Gesellschaft
Elfte wissenschaftliche Tagung der Peter-Hacks-Gesellschaft
Am Sonnabend, 10. November fand im Magnus-Haus, Berlin die elfte Tagung zu Werk und Leben von Peter Hacks statt.
Mit dem Tagungsthema suchte die Hacks-Gesellschaft Anschluss an eine Diskussion, die durch den Dramaturgen Bernd Stegemann im Jahre 2015 ausgelöst worden war. Es geht um den Realismus. Den Realismus auf dem Theater. Es geht aber nicht bloß um Abbildung und Widerspruch, Gattung und Zeit, Material und Form, Entwurf und Weltbegriff, Fiktion und Wirklichkeit, es geht auch um das Verhältnis von Drama und Theater.
Die Moderation des Vormittags übernahm Detlef Kannapin. Er gab mit drei Zitaten einen Rahmen, der den Realismus allgemein berührt. Zu Wort kam zunächst Hegel, demnach der Dramatiker die volle Einsicht sowohl in die gesellschaftlichen Verhältnisse als auch die gesellschaftlichen Entwürfe benötige. Er besorge also mehr als bloße Diagnose seiner Zeit. Im Drama indes prallen die notwendig subjektiven Positionen aufeinander, und des Dramatikers Pflicht sei, diese Einseitigkeiten zum Höheren hin aufzulösen. Das zweite Geleit entnahm Kannapin dem Werk von Georg Lukács, der den objektiven Widerspiegelungscharakter der Kunst nicht als Abwesenheit subjektiver Verzerrung verstehen will. Schließlich kam Hacks zu Wort mit einer Passage zum Verhältnis des dramatischen Helden und des gesellschaftlichen Fortschritts. Auch ihm geht es, wie Hegel und Lukács, um den notwendigen und angemessenen Platz des Subjektiven. Wenn Ändern nicht bloß Reformieren nach Maßgabe der Zeit sein soll, muss Handeln über sie hinausweisen.
Peter Schütze sprach über das Verhältnis des Dramatikers Hacks zum Theater unter den Zuständen eines Betriebs, der dramatische Maßgaben überhaupt anzuerkennen sich weigert. Das prononcierte Diktum des Dichters, er interessiere sich nicht für Theater, betreffe nicht die Aufführung, sondern den Prozess der Proben und die organisatorischen Abläufe. Gewiss habe Hacks das Primat des Dramas vor dem Theater gesetzt; zu Recht im Übrigen, denn Drama könne ohne Theater, es habe stets einen unvermittelten Zugang zur Welt, weil es Literatur ist. Aufführbarkeit sei indes eine genuine Eigenschaft der dramatischen Gattung, und ein entsprechend geschriebenes Stück besitzt diese Eigenschaft unabhängig davon, ob es aufgeführt wird oder nicht. Der Frage nachgehend, wie theatralisch nun Hacksens Stücke seien, stellte der Redner fest, dass es an Angeboten des Dichters nicht gemangelt habe und die Stücke mit der Zeit immer offener für theatralische Interpretationen wurden. Hacks habe sich in seinen Reflexionen theatralischen Fragen nicht verschlossen, was Kommentare zum Betrieb, Nachdenken über Bühnenbild und Schauspieler, nicht zuletzt elaborierte Analysen für Theaterleute wie Esche und Solter beweisen. Gegen das Regietheater wurde der Schauspieler für Hacks zum Verbündeten. In Esche fand Schütze ein anschauliches Subjekt für den Niedergang des Theaters seit den siebziger Jahren: den vom Regietheater ins Soloprogramm gezwungenen großen Darsteller.
In der Diskussion kam Hacksens Ablehnung der abstrakten Kunst zur Sprache, die nicht bloß eine Frage des persönlichen Geschmacks war. Hacks habe darauf bestanden, dass Kunst sich nicht in ihrer Erkenntnisfunktion erschöpfe und Schönheit immer anschauliche Schönheit sei.
In seinem Vortrag über den Realismus der DDR-Literatur aus den sechziger Jahren erklärte Thomas Wieck denselben für nicht vorhanden und insonders Hacksens Auffassung der sozialistischen Gesellschaft für irrelevant. Der habe sein Werk »ins politische Niemandsland und die Bedeutungslosigkeit« katapultiert; seine Dramen seien »immer realitätsferner und fremder« geworden. Wieck stellte die Frage: »Warum spielt heute alle Welt noch Brecht, und wie kam es dazu, dass Hacks im theatralischen Abseits strandete?« Bei der Beantwortung dieser Frage ließ er die Geschichte der Hacks-Boykotte und -Verbote ebenso beiseite wie die politische Spaltung des Publikums in den letzten zwei Jahrzehnten der DDR sowie die naheliegende Antwort, dass der unter kapitalistischen Verhältnissen arbeitende Brecht heute, da wieder solche herrschen, naturgemäß mehr zu interessieren weiß als Hacks, der sich mit Fragen des Sozialismus beschäftigte. Hacksens Abwendung vom Theaterbetrieb der DDR zu Beginn der siebziger Jahre wurde von ihm als Abkehr von der Wirklichkeit überhaupt gedeutet. Die Realismusfrage verknüpfte Wieck ohne weitere Vermittlung mit der Erfolgsfrage: Bleibender Erfolg eines Stücks hänge davon ab, wie treffend es die Fragen seiner Zeit beantworte. Zum anderen setzte Wieck eine stark zugeschnittene Definition von Realismus. Nicht das Verhältnis zur Wirklichkeit überhaupt, zur Vielzahl der Probleme und Bewegungsformen des Sozialismus, entscheide über den realistischen Charakter eines Werks dieser Epoche, sondern allein die Behandlung des Problems von Autorität und Selbstverwaltung der Arbeiterklasse vor dem Hintergrund der faschistischen Vergangenheit.
In der Diskussion wurde darauf hingewiesen, dass der Vortrag die politischen Gründe für die Absetzung von Hacks-Stücken außer Acht lasse. Ein anderer Kommentar verwies auf den selektiven Sozialismusbegriff Wiecks. Dieser entgegnete hierauf, dass man nicht wissen könne, welches Sozialismuskonzept sich als richtig erweisen werde. Die Frage, warum er dann einen solch unsicheren Begriff zur Grundlage nehme, den Realismus der sechziger Jahre zu verneinen, beantwortete er nicht.
Ihren kursorischen Vortrag über den Zusammenhang der ästhetischen Vorstellungen von Hacks und Lukács begann Kristin Bönicke, sie wolle sich beschränken auf das Spätwerk, insbesondere die »Eigenart des Ästhetischen«. Hacks und Lukács habe der Kampf gegen die Liquidation des Werkbegriffs verbunden. Ein Werk allerdings liefere seine Deutung selbst mit und bedürfe nicht notwendig der auxiliaren Erläuterung durch seinen Urheber. Kunst, die sich ans Publikum richtet und nicht bloß der privaten Erbauung des Künstlers dient, müsse welthaltig sein. Sie sollte aber auswählen, das Typische im Besonderen hervortreten lassen, wodurch Realismus erreicht wird ohne die Gefahr der Langeweile. Hierbei verknüpfte die Rednerin die Eigenschaft der Kunst, gerade durch das Erfassen des Vorhandenen über das Vorhandene hinauszuweisen, mit der Politik, denn »die Zukunft, das ist der Kommunismus«. Das bedeute nach Lukács jedoch nicht, dass der »subjektive Faktor« auszuschließen sei. Da es in der handlungstragenden Kunst um Möglichkeiten des Menschen zum Handeln geht, erkläre sich, warum Hacks seinerseits, obgleich Kommunist, das Königsdrama bevorzugte. Auch in der Frage der Form habe zwischen Lukács und Hacks Einigkeit geherrscht; Form setze dem ausladenden Anspruch des Realismus, Wirklichkeit zu erfassen, eine Grenze, und allein als Werk, als abgeschlossene Form also, könne Kunst wirken.
Auf Nachfrage aus dem Publikum erläuterte Bönicke, dass ihr Schwerpunkt bei den Gemeinsamkeiten der ästhetischen Vorstellungen von Hacks und Lukács gelegen habe. Eine Differenz zwischen beiden liege z. B. darin, dass Hacks das Schöne stärker gewichte und ihm eher eine autonome Stellung innerhalb des Kunstzusammenhangs zubillige, als Lukács das tat.
Den Nachmittag der Tagung, nunmehr moderiert von Constanze Kraft, eröffnete Felix Kupfernagel mit Überlegungen zur Analogie der Stücke »Moritz Tassow« und »Torquato Tasso«. Für Hacks sei »Moritz Tassow« ein wichtiges Stück geblieben, weil es die Frage nach dem Künstler in der Gesellschaft berühre. Es verwundere, dass die Beziehung der beiden Stücke, im Angesicht der klar erkennbaren Anspielung durch den Namen und der thematischen Schnittmengen, noch nie einer gründlicheren Untersuchung unterworfen wurde. Für Kupfernagel liegt das nähere Verhältnis der Stücke vor allem in der Ähnlichkeit ihrer beiden Titelfiguren. Tassos »Erlaubt ist, was gefällt« werde nachgerade zur Folie für Tassows Verachtung jedwedem Menschen gegenüber, der »äußre Lenkung duldet, fremden Auftrag / Annimmt und macht, was er nicht will, und nicht / Macht, was er will«. Dabei verharre Tasso in elegischer Wehmut, während Tassow aus seinem Voluntarismus eine nach vorn gerichtete utopische Idylle forme. Tassow sei nicht rundweg als Narr zu begreifen, da seine Politik leninistische Inhalte befördere, nur eben zur falschen Zeit. Dort greife Mattukats Wort, dass man recht immer nur hier und jetzt haben könne. Der Anarchismus Tassows, so lässt sich zusammenfassen, liegt nicht im Inhalt, sondern in der Haltung.
Aus dem Publikum gab es Anmerkungen und Ergänzungen zur Feinstruktur und zu den Grenzen der Analogie beider Stücke, zur Differenz von Transformation und Übertragung, zu den Quellen des »Tassow« im Drama des Biedermeier, zur Rückläufigkeit der Utopie im Stück.
Jens Mehrle widmete sich der Frage nach dem Verhältnis von Drama und Theater bei Hacks mit besonderer Rücksicht auf das durch die »Berlinische Dramaturgie« überlieferte Material. Zur Eröffnung wies er auf den immensen Erfolg der Hacksschen Dramen auf deutschen Bühnen während der sechziger und siebziger Jahre hin. Der zunehmende Unwille des Dichters am Theater setzte am Höhepunkt seiner Erfolge dort ein. In der Akademie, urteilte Mehrle, zeichneten sich für Hacks zwei große Differenzen ab. Offenkundig im Gefolge des Jahres 1968 schwand bei einer Gruppe von Schriftstellern der »Grundkonsens einer sozialistischen Perspektive, der sie mit der DDR verbunden hatte«; das betreffe die Strömung, die Hacks später als »Romantik« bezeichnete. Die andere Differenz betreffe die Entwicklung des Regietheaters als von der Dramatik unabhängiges Treiben im theatralischen Betrieb. Mehrle erinnerte daran, dass die Divergenz von Hacks und Theater nicht vom Dichter ausging, sondern bereits im Konzept des Regietheaters angelegt ist. Auf ein Theater, das den dramatischen Dichter für unzuständig erklärte, habe der dramatische Dichter Hacks folgerichtig mit Rückzug von diesem Theater reagiert. Anschaulich werde die Akzentverschiebung durch das Regietheater auch daran, dass die politischen Skandale der sechziger Jahre noch die Stücke betroffen hatten, während die Skandale der Siebziger durch die Inszenierungen ausgelöst wurden. Das Drama habe Hacks aufgefasst als poetische Gattung mit Orientierung zur Spielbarkeit. Nichts sei theatralischer als eben das Dramatische, weil nichts auf der Bühne spannender wirke als eine gut erzählte Handlung. Die Eigenschaft der Spielbarkeit unterscheide sich dennoch von der des Dramatischen. Theatralische Technik (Drehbühne, Kulisse usw.) habe Hacks nicht abgelehnt, allerdings die Auffassung vertreten: je weniger Technik, desto besser. Im letzten Teil seines Vortrags umriss Mehrle eine Konzeption realistischen Theaters im Sozialismus, die sich aus der Zusammenschau der Hacksschen Akademie-Äußerungen gewinnen lässt. Bezüglich der gegenwärtigen Debatte zum Realismus auf dem Theater kritisierte der Redner, dass das Thema von Theaterpraktikern und -gelehrten im Wesentlichen ohne einen Begriff von Drama geführt werde.
In der Diskussion benannte Mehrle die Ablehnung der revolutionären Romantik als eine Grundtendenz des Sozialistischen Realismus; diese Romantik sei eine Schwachstelle der marxistischen Ästhetik. Auch auf das Regietheater kam er noch einmal zurück, indem er die Formel von der »Befreiung des Schauspielers« als im Kern bereits romantisch sowie als Irreführung deklarierte.
Nach Mirjam Meuser bezeigt die Debatte um Stegemanns »Lob des Realismus« eine Spaltung in der ästhetischen Diskussion, die auf das Zerbrechen der postmodernen Gewissheit vom Ende der Geschichte zurückgehe. Heute formiere sich ein Lager des Realismus gegen eines der verbleibenden Postmoderne. Alle postmodernen Varianten werden, wie Stegemann betone, unbewusst systemapologetisch und erzeugen einen postmodernen Universalismus, dem alles, was sich dem Bewusstsein eindrückt (ob wahrgenommen oder eingebildet), als wirklich gilt, wonach Darstellung von etwas und Darstellung als ihr eigener Inhalt ununterscheidbar werden. Dieser ästhetische Relativismus habe sich aber selbst zur Normpoetik entwickelt. Peter Hacks, führt Meuser fort, stellte in der Diskussion zum Sozialistischen Realismus ganz ähnliche Fragen und wendete sich gegen beide Richtungen, die Enge des Dogmatismus und die Beliebigkeit des postmodernen Relativismus. Für Hacks und Stegemann gelte gleichermaßen, dass zu realistischer Kunst Interesse an Welt, dialektisches Denken und politisches Bewusstsein gehören. Die Funktion der Kunst bestehe in Erkenntnis. Postdramatische Strebungen, die Drama und Theater entkoppeln, haben sich, ausgehend von Hans-Thies Lehmann, nachhaltig durchgesetzt. Die lange Wirkung der Argumentation Lehmanns zeige sich etwa beim jungen Autor Wolfram Lotz, der sich explizit für den Realismus ausspricht. Nach ihm werde Realismus der Motor des Schreibens im Sinne eines »unbedingten Interesses für die Wirklichkeit«. Realismus sei für Lotz dort gegeben, wo der Schreibende seinen Text als nicht ausreichend anerkennt. Hierin machte Meuser eine Gemeinsamkeit von Hacks, Lotz und Stegemann fest. Die große Differenz liege aber genau am Dramatischen, insofern Lotz konträr zu Hacks das dramatische Genre als ungenügend versteht, Wirklichkeit zu erfassen. Die Diskussion eröffnete mit mehreren Beiträgen zu Widersprüchen bei Lotz, insbesondere seiner halbherzigen Distanzierung vom postdramatischen Theater, dem er sich gleichwohl noch unterwerfe, um weiter gespielt zu werden. Auch seine Unlust, sich im ästhetischen Zusammenhang politisch zu positionieren, wurde kritisiert.
Das komplette Tagungsprogramm als Flyer zum Download.
Die Referate der Tagung werden im Jahrbuch 2019 der Peter-Hacks-Gesellschaft veröffentlicht.
Mit freundlicher Unterstützung von: